Positive und negative Entwicklungen welche zum Nachdenken anregen
Gerhard Kammerlander
Seit den 1990er Jahren hat sich die Bildungslandschaft im Bereich Wundmanagement europaweit stark entwickelt. Es gibt eine Vielzahl von lokalen Anbietern von Wundmanagement-Weiterbildungen sowie internationale Organisationen, die in diesem Bereich aktiv sind. Zu den bedeutendsten Institutionen auf europäischer und globaler Ebene zählen die EWMA (European Wound Management Association) und die WUWHS (World Union of Wound Healing Societies). In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter von Schulungen im Bereich Wundmanagement. Diese reichen von privat organisierten Veranstaltungen über Weiterbildungen an Fachhochschulen und Privatuniversitäten bis hin zu gemeinnützigen Vereinen. Beispiele: Austrian Woundmanagement Association e.V. (AWA), Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. (DGfW), Initiative Chronische Wunden e.V. (ICW).
Gerhard Kammerlander, MBA, akad.BO, DGKP/ ZWM®-ZertifizierterWundManager nach §64 GuKG
Mittlerweile tummeln sich vor allem in Deutschland erheblich mehr Bildungsanbieter im Bereich Wundmanagement als die zuvor genannten Organisationen. Die quasi unüberschaubare Anzahl erschwert die Auswahl für Bildungssuchende erheblich und überfordert viele, da die Qualitätsunterschiede sowie die mögliche Praxistauglichkeit zwischen den Anbietern oft schwer zu erkennen sind.
Es wird daher den Bildungssuchenden empfohlen, sich gründlich im Internet über die verschiedenen Fortbildungsanbieter zu informieren. Dabei sind einige Auswahlkriterien zu beachten:
- Wie lange besteht die Institution bereits, wer ist der Träger und wie finanziert sich die Organisation, durch Dienstleistungen oder Sponsoring (eventuell beides)?
- Wird die Qualität der Weiterbildungen regelmäßig fachlich überwacht?
- Verfügt die Bildungsinstitution über Qualifikationsnachweise gemäß ISO- oder EN-Normen für ihre Arbeit?
- Gibt es im Internet Literatur über die Aktivitäten der Institution und wie viele Personen wurden bisher ausgebildet?
- Ist die Weiterbildung spezifisch für Ärzte, Pflegende oder beide Gruppen konzipiert?
- Wird die Weiterbildung so gestaltet, dass Pflegende und Ärzte gemeinsam im selben Kurs geschult werden, um Wissenssynchronisation zu fördern?
- Wie ist der Ruf der Institution unter den Teilnehmern, die bereits Erfahrungen mit anderen Bildungsanbietern im Bereich Wundmanagement gemacht haben?
Diese und weitere Fragen sollten vor der Auswahl einer Bildungseinrichtung sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Weiterbildung den eigenen Anforderungen und Qualitätsstandards entspricht.
Die wichtigsten etablierten Anbieter
Die Bildungsanbieter, die seit den 1990er und Anfang der 2000er Jahre die größte Bedeutung für die Marktbearbeitung erlangt haben, sind im Hinblick auf ihre historische Entwicklung:

Die Akademie-ZWM® AG ist als Pionierinstitution im länderübergreifenden, standardisierten Wundmanagement mit Standorten in der Schweiz und Österreich eine privat organisierte Einrichtung. Sie bietet bereits seit 1992 Weiterbildungen im Bereich Wundmanagement in der DACH-Region an. Die Akademie ist mit zwei eigenen WundKompetenz-Zentren (WKZ® in Linz (Österreich) und WKZ®-Embrach/Zürich (Schweiz)) sowohl in der praktischen Umsetzung als auch in der Theorie und Wissenschaft des Wundmanagements länderübergreifend aktiv
Seit 2003 wird die Qualitätssicherung der Behandlungsbetriebe und der Schulungseinrichtungen der Akademie-ZWM® durch den TÜV AUSTRIA jährlich durch Vor-Ort-Prüfungen überwacht. Dadurch sind die Institutionen gemäß den Standards ISO 9001, ISO 21001 und EN 15224 zertifiziert. Eine Besonderheit ist, dass die Institution freiwillig strenge externe Überwachungen durchführt, um die Qualität von Bildung und Behandlung sicherzustellen. Die Qualifikationstitel (WM®/WDA®/ZWM®) und Projekttitel (AHW®/WZ®/WKZ®) sind europaweit als einzigartige Titel geschützt und basieren auf klar definierten curricularen Inhalten.
Die Finanzierung der Wundkompetenzzentren und der Weiterbildungsaktivitäten erfolgt ausschließlich über die erwirtschafteten Einnahmen aus der Patientenversorgung und der Fortbildungstätigkeit. Die Wundmanagement-Kongresse werden zusätzlich durch Beiträge der ausstellenden und beteiligten Unternehmen unterstützt. Es erfolgt darüber hinaus kein monetäres Sponsoring (s. www.akademie-zwm.ch).

Die DGfW wurde 1994 in Wiesbaden als interdisziplinäre wissenschaftliche Fachgesellschaft gegründet. Ihr Ziel ist es, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis zur verbesserten Behandlung akuter und chronischer Wunden zu unterstützen und die interprofessionelle Zusammenarbeit von Ärzten und Gesundheitsfachberufen zu fördern.
Die Mitglieder der DGfW kommen aus verschiedenen Disziplinen der Medizin, Gesundheitswissenschaften sowie anderen Naturwissenschaften und Ausbildungsberufen des Gesundheitswesens. Das Curriculum der DGfW ähnelt dem der Akademie ZWM®. Die DGfW sieht sich als führende wissenschaftlich orientierte Organisation in Deutschland für das Thema akute und chronische Wunden (vgl. www.dgfw.de).
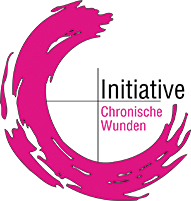
Die Initiative Chronische Wunden wurde 1995 von Ärzten, Pflegenden, Mitarbeitenden der Kostenträger und anderen Engagierten ins Leben gerufen, um die Prophylaxe, Diagnostik und Therapie von Menschen mit chronischen Wunden zu verbessern. Als medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft strebt die Initiative eine praxisnahe und flächendeckende optimale Versorgung der Betroffenen an. Am 22. Juli 2002 fand in Göttingen die Gründungsversammlung als eingetragener Verein statt. Seitdem kann jede Person persönliches Mitglied werden, während Unternehmen als Förderkreismitglieder dem Verein beitreten können (s. www.icwunden.de/ueber-uns).
Der ICW ist insgesamt professionell organisiert und engagiert sich mittlerweile auch international. Die etablierte Zeitschrift Wundmanagement, das Hauptpublikationsorgan der ICW, enthält regelmäßig nützliche Fachbeiträge.
Gemeinsame Zielsetzungen der Fortbildungsinstitutionen
Grundsätzlich sind die primären Zielsetzungen der Veranstalter von Weiterbildungen im Wundmanagement, die Strukturqualität und interprofessionelle Behandlungsqualität nachhaltig zu verbessern. Dies ist bereits teilweise mit der Erkenntnis gelungen, dass noch viele Bereiche optimiert und verbessert werden müssen. Vor allem sollte die Qualität der Weiterbildungsinhalte nicht allein anhand eines Lehrplans beurteilt werden, sondern vielmehr durch Validierungen und den Vergleich der Fortbildungsqualität.
Die besten Beurteiler der Weiterbildungsqualität sind oft die Absolventen selbst, die ihre persönlichen Erfahrungen teilen können. Wichtig ist dabei, zu analysieren, ob die Weiterbildung die Umsetzungsqualität und die Sicherheit in der Patientenversorgung verbessert hat. Besonders aufschlussreich sind Teilnehmer, die im Laufe der Jahre verschiedene Weiterbildungen absolviert haben und somit einen direkten Qualitätsvergleich durchführen können.
Der G-BA und seine Bedeutung
Durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG) hat der Gesetzgeber in Deutschland zur Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden eine entsprechende Neuregelung in § 37 Absatz 7 SGB V in der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) verabschiedet. Dadurch kann die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden auch in spezialisierten Einrichtungen wie WundZentren außerhalb der Häuslichkeit als HKP-Leistung erfolgen.
In §1 Abs. 3 HKP-RL heißt es: „Die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden soll vorrangig im Haushalt der oder des Versicherten gemäß Absatz 2 erfolgen. Kann die Versorgung der chronischen und schwer heilenden Wunde aufgrund der Komplexität der Wundversorgung oder den Gegebenheiten in der Häuslichkeit voraussichtlich nicht im Haushalt der oder des Versicherten erfolgen, soll die Wundversorgung durch spezialisierte Einrichtungen außerhalb der Häuslichkeit erfolgen. Dies muss aus der Verordnung hervorgehen. Für die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden nach Satz 1 und 2 ist die Leistung nach Nr. 31a zu verordnen.“
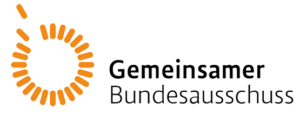
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in der HKP-RL, welche am 06.12.2019 in Kraft getreten ist, das Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen um die Nr. 31a und Nr. 31b ergänzt. Die Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde (Nr. 31a) soll ausdrücklich von einem Leistungserbringer, der sich auf die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden spezialisiert hat, erfolgen. Eine Kompressionsbehandlung (Nr. 31b) ist in gegebenen Fällen zusätzlich verordnungsfähig.
Folgende Punkte sind gemäß HKP-RL bei der Verordnung zu beachten:
- „Die Dauer der Erst- sowie die Folgeverordnung für die Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde beträgt jeweils bis zu 4 Wochen.
- Es sind die Wundart, Lokalisation, Länge, Breite, Tiefe und soweit möglich der Grad der Wunde sowie die zu verwendenden Verbandmaterialien anzugeben.
- Die Wechselintervalle der Wundverbände sind abhängig von der Wundsituation und den verwendeten Verbandmaterialien anzugeben.
- Vor der Folgeverordnung hat die Ärztin oder der Arzt ggf. den dokumentierten Positionswechsel (Nr. 12) sowie die Wunddokumentation, ggf. die Fotodokumentation und weitere Informationen aus der Pflegedokumentation auszuwerten und prognostisch einzuschätzen, ob die Therapie erfolgreich ist, ggf. angepasst werden muss und unter ambulanten Bedingungen zum Ziel führen kann.
- Sofern im Zusammenhang mit dem Anlegen und Wechseln von Wundverbänden eine Kompressionsbehandlung erforderlich ist, ist dies auf der Verordnung anzugeben.“
Hierzu ist anzumerken, dass die qualitativen Überprüfungen der einzelnen spezialisierten Wundeinrichtungen in Deutschland sehr unterschiedlich ausfallen. Der G-BA gibt hier lediglich die Grundrichtlinie vor für die personellen, räumlichen und qualitativen Grundvoraussetzungen.
Die internen Qualitätsstandards in Wundzentren oder Wundkompetenzzentren variieren erheblich. Dies betrifft sowohl die Qualität der Weiterbildung des Personals als auch die Qualitätssicherung innerhalb der Einrichtungen, insbesondere im ambulanten Bereich. Zum Teil erfüllen die bestehenden Weiterbildungen im Bereich des Wundmanagements seit jeher diese Voraussetzungen und übersteigen diese sogar, z. B. die des DGfW und der Akademie-ZWM®.
Bekannteste und renommierteste Beispiele in Deutschland sind die seit über 25 Jahren bestehenden WZ-WundZentren® und WKZ-WundKompetenzZentren®. Als geschützte europäische Marken unterliegen sie den strengen TÜV-Austria-Prüfkriterien nach ISO-Norm sowie hohen curricularischen Anforderungen. So durchlaufen die lehrenden Wundspezialisten und -spezialistinnen einen fortlaufenden Prozess der fachlichen und betrieblichen Qualitätssicherung, die durch interne Maßnahmen sowie jährliche Qualitätsprüfungen der Dokumentation gewährleistet wird.

Behandlungsraum in einem WZ-WundZentrum Deutschland (www.wundzentren.de)
Ausblick für spezialisierte Wundeinrichtungen nach G-BA
Die Aussichten für spezialisierte Wundeinrichtungen in Deutschland sind grundsätzlich vielversprechend. Die Akteure im Gesundheitswesen, die die Bedeutung dieser Einrichtungen erkannt haben und bereits erheblich investiert haben, kämpfen jedoch nach wie vor mit der bürokratischen Hürde der Anerkennung und Refinanzierung über die Krankenkassen. Während einige Bundesländer hierbei schneller vorankommen als andere, gestaltet sich der Weg für Betreiber, die bereits beträchtliche Ressourcen in Kapital und Personal investiert haben, oft noch mühsam. Insbesondere in Regionen, in denen trotz Erfüllung aller Voraussetzungen die Anerkennung durch einige Krankenkassen noch aussteht, bleibt die Situation herausfordernd.
Herausforderungen für qualifizierte Fortbildungen im Wundmanagement
Der G-BA gibt in diesem Zusammenhang für Deutschland klare Regeln und Voraussetzungen, sowohl für die Qualifikation der Leitungen als auch für das lehrende Fachpersonal, vor:
- www.g-ba.de/presse/presse-mitteilungen-meldungen/804/
- www.g-ba.de/downloads/34-215-804/21 2019-08-15 HKP-RL chronische-Wunden.pdf
- G-BA: www.t1p.de/y0ujg.
Dazu wurde ein Lehrplan vorgestellt, der die grundlegenden fachlichen Anforderungen an die Ausbildung von Wundtherapeuten definiert. Danach müssen die auszubildenden, zukünftigen Wundtherapeuten mindestens 84 Unterrichtseinheiten in der Basisschulung absolvieren. Allerdings werden von den meisten bereits aktiven Fortbildungsinstitutionen im deutschsprachigen Raum diese Mindestanforderungen nicht erfüllt. Um die erforderlichen Standards zu erreichen müssen sie folglich nach Inkrafttreten dieser Vorgaben ihre bisherigen Absolventen entsprechend nachschulen.
Erfüllen die Fortbildungsanbieter diese Anforderungen bereits, wie bspw. die zertifizierte Akademie-ZWM® seit 1999 in der D.A.CH-Region oder die DGfW in Deutschland seit 2007, müssen ihre Absolventen und Absolventinnen nicht nachgeschult werden.
Behandlungsqualität aufrecht erhalten – wie geht das?
Grundsätzlich liegt es in der individuellen Verantwortung eines jeden Wundtherapeuten, sein Wissen auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Medizin zu halten. Um die kontinuierliche Aktualisierung des Wissens sicherzustellen, verlangen Bildungsinstitutionen wie bspw. die Akademie-ZWM®, die DGfW und die ICW periodisch den Nachweis von Weiterbildungsstunden. Dabei akzeptieren die Akademie-ZWM® und die DGfW auch unbürokratisch Bildungsstunden anderer Anbieter, wenn diese Bildungsstunden nachweislich den benötigten fachlichen Anforderungen und Qualifikationen entsprechen.
Demgegenüber gestaltet sich für Fremdveranstalter die Beantragung von Bildungspunkten bei der ICW leider weiterhin als langwierig und kompliziert. Die geforderten Informationen bzgl. Referentenqualifikationen und Vortragsqualität sind übermäßig umfangreich. So werden erschwerend unter anderem auch die Präsentationen der Referenten und Referentinnen verlangt, welches aufgrund von Urheberrechten nicht problemlos möglich ist. Darüber hinaus müssen Fremdveranstalter wie z. B. die Akademie-ZWM® für jeden ICW-Besucher, der anerkannte Punkte von der ICW erhalten möchte, zusätzlich Gebühren an die ICW abführen. Insgesamt resultieren aus den überhöhten Anforderungen der ICW erhebliche zeitliche Verzögerungen, was oft die Vergabe von Fortbildungspunkten unmöglich macht.
Dies erscheint in Zeiten von Fachpersonalmangel und freier Marktwirtschaft als nicht nachvollziehbar und zu Ungunsten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als fortbildungshemmend. Bei allem Respekt und Verständnis stellt sich hier die Frage, ob diese Praktiken rechtens sind und ob andere Anbieter durch solche Maßnahmen ausgegrenzt werden sollen? Wird darauf abzielt, einmal ausgebildete Absolventen dauerhaft an die Institution zu binden?
Der Autor strebt selbstverständlich danach, dass alle seriösen Bildungsinstitutionen im Bereich der Wundversorgung einen respektvollen, aufrichtigen und transparenten Umgang pflegen. Dies ist im Interesse aller, die sich freiwillig im Bereich des Wundmanagements weiterbilden und engagieren möchten.
Resümee
Es ist festzuhalten, dass die Entwicklung spezialisierter Wundeinrichtungen in Deutschland durchaus positive Fortschritte zeigt. Obwohl noch einige Hürden zu überwinden sind, werden diese letztendlich gelöst werden.
Der Markt für Wundmanagement-Weiterbildungen in Deutschland ist äußerst stark frequentiert, weshalb jeder Interessierte sich vorab gründlich informieren sollte, welcher Weg basierend auf Fakten und Recherchen am sinnvollsten erscheint.
Die Bildungsinstitutionen sollten weiterhin im Rahmen eines seriösen und transparenten Wettbewerbs miteinander kommunizieren und harmonisch aktiv sein, ohne andere Bildungsanbieter auszuschließen oder zu behindern, es sei denn, es werden unseriöse Methoden verwendet.
Autor:
Gerhard Kammerlander, MBA. Akad. BO, DGKP/ZWM®, GF – WKZ®-WundKompetenzZentrum® Linz (AT) und Embrach /Zürich (CH), GF – Akademie-ZWM®, Embrach/Zurich (CH) und Linz (AT); Prasident ARGE ZWM®-ZertifizierterWundManager®, Akademie-ZWM® AG, Schützenhausstr. 30, CH-8424 Embrach, www.akademie-zwm.ch

